|
|
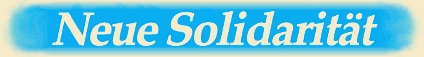
China trifft Europa
Stephan Ossenkopp berichtet über den Hamburger Kongreß „China meets Europe“.
Unter dem Motto „China meets Europe“ lud am 23. und 24. November die liberale europäische Wirtschafts- und Politikelite erneut ihre Freunde aus China nach Hamburg ein. Waren die einen durch Brexit und Trump-Wahl sichtlich irritiert, wirkten die anderen deutlich optimistischer und zuversichtlicher.
Der Präsident der Vereinigung der Europäischen Industrie- und Handelskammern, Dr. Richard Weber, lehnt sich weit aus dem Fenster, als er beim Panel über eine neue internationale Handelsordnung verkündet: „Das süße Gift des Freihandels kann nicht gestoppt werden!“ Auch die Vertreterin des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus neben ihm spricht ständig von der „Gefahr der Rückkehr des Protektionismus“.
Donald Trumps Ankündigung, aus den Freihandelsabkommen wie TPP und TTIP auszusteigen, hat in der EU das blanke Entsetzen hervorgerufen. Der Moderator des Panels, Björn Conrad von der neoliberalen Denkfabrik MERICS, beklagte, alle Debatten über die USA als Verteidiger des Freihandels seien nunmehr „irrelevant“ geworden.
Der ehemalige australische Premierminister Kevin Rudd sprach zuvor in seiner Grundsatzrede gar vom gewaltigsten Bruch des politischen Konsenses seit Franklin D. Roosevelt. Die Zukunftsaussichten seien derart trübe, daß die USA sogar Handels- und Währungskriege mit China beginnen könnten, da Trump China während des Wahlkampfes als Bedrohung erklärt habe. Deutschland und China, beides Handelsnationen mit langer Tradition, müßten nunmehr die Werte der globalen politischen Mitte verteidigen.
MERICS-Chef Sebastian Heilmann sprach unentwegt von „dunklen Wolken am Horizont“, „steigenden Risiken“ und „Problemen“ bei der chinesischen Wirtschaft. Doch sehr überzeugend wirkten keine der angebotenen Dramaturgien und Erzählstränge der neoliberalen Denkschule. Das „süße Gift“ wirkt nicht mehr. Die überwiegende Mehrheit der Menschheit ist längst vom attraktiveren Modell der Neuen Seidenstraße und der Win-Win-Partnerschaften angezogen.
Prof. Mao Zhenhua, Vorsitzender eines großen chinesischen Kreditfonds, gab zu erkennen, man habe sich ergänzende Interessen mit den USA und werde deswegen gut zusammenarbeiten - mit oder ohne Trump. Chinas Export in die Vereinigten Staaten sei in etwa gleichauf mit dem Export nach Europa. Das Aus für das transpazifische Freihandelsabkommen TPP sehe man eher positiv, da es sowieso gegen Chinas Interessen gerichtet gewesen sei. Yu Weiping, Vizepräsident beim Hersteller von Chinas Hochgeschwindigkeits-Bahnsystem, hat mit seiner 30jährigen Erfahrung als Eisenbahner die gigantischen Umwälzungen in Chinas Gesellschaftsstrukturen miterlebt. Im Zentrum dieses neuen China stehe das Netzwerk der Schnellzüge, mit denen man von Beijing aus in sechs Stunden 54 Großstädte erreichen könne. Selbst damit sei man längst nicht zufrieden. Man werde es in ein interkontinentales Personen- und Güterverkehrsystem verwandeln, zu einer Neuen Seidenstraße. In die USA habe man bereits 846 U-Bahn-Waggons geliefert. Außerdem schließe man mit dem Ansatz der Win-Win-Partnerschaften ständig Kooperationsverträge mit deutschen Unternehmen.
Entsprechend begeistert ist das Echo von denjenigen Unternehmen, die das Modell verstanden haben und gerne umsetzen wollen. Hubertus Troska vom Daimler-Vorstand schildert, daß man sowohl mit den großen staatlichen als auch mit den privaten chinesischen Firmen im Rahmen von Joint Ventures exzellent zusammenarbeite und Wachstumsraten von bis zu 35% verzeichnen könne, während 100%igen Töchtern ausländischer Unternehmen in China auch ohne Beschränkungen weniger Erfolg beschieden sei.
Europäische und amerikanische Unternehmer und Diplomaten stehen also eigentlich vor einer sehr einfachen, weil prinzipiellen, Entscheidung: Werden Sie sich dem von China angebotenen Win-Win-Modell anschließen und somit mithelfen, der gesamten Menschheit ein auf Entwicklung und Zusammenarbeit basierendes System zu ermöglichen? Oder werden sie sich von den Gespenstergeschichten der transatlantischen Geopolitiker ins ewig gestrige Denkschema pressen lassen, das bereits zu zwei Weltkriegen geführt hat?
In die richtige Richtung wies die Rede des neuen Ehrenvorsitzenden des „China meets Europe“-Gipfels, Ex-Kanzler Gerhard Schröder, der von einer strategischen Partnerschaft zwischen China und Deutschland sprach, die trotz der unterschiedlichen politischen Systeme auf Kooperation, nicht Konfrontation ausgerichtet sein müsse. Im Gegensatz zu seinem Parteigenossen, Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, sprach sich Schröder ausdrücklich für den Austausch von Technologien aus. Auch eine gemeinsame diplomatische Initiative zur Beilegung des Konfliktes in Syrien solle angegangen werden.
Das alles sind richtige Einzelpunkte. Eine umfassende Vision für die Neugestaltung der Welt unter einem neuen Paradigma hat indessen nur die LaRouche-Bewegung mit seiner Studie über die„Weltlandbrücke“ vorgelegt. Deutsche Unternehmerverbände täten gut daran, diese ausführlich zu studieren, um für die kommenden Herausforderungen gewappnet zu sein.
Stephan Ossenkopp