|
|
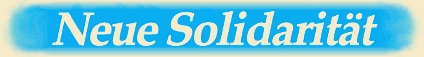
Schweizer lehnen schnellen Atomausstieg ab
Die Schweizer Wähler haben in einem Referendum am 27. November einen Plan für den beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie mit 54,2% klar abgelehnt. Das Resultat kam für alle, die den Umfragen geglaubt hatten, überraschend, denn diese hatten noch kurz zuvor eine Mehrheit für den Ausstieg vorausgesagt.
Der von den Schweizer Grünen initiierte Antrag lautete, Kernreaktoren nach 45 Jahren Betrieb stillzulegen, was bedeutet hätte, drei der fünf Schweizer Kernkraftwerke, nämlich Beznau I und II sowie Mühleberg, schon 2017 vom Netz zu nehmen, das vierte dann 2024 und das letzte 2029. Die fünf Kernkraftwerke liefern heute etwa ein Drittel des Stroms in der Schweiz.
Eines der entscheidenden Netzwerke, das gegen den Ausstieg mobilisierte, war das „Carnot-Cournot-Netzwerk für Politikberatung in Technik und Wirtschaft“ (siehe Neue Solidarität 48/2016). Es legte überzeugend dar, warum die grünen Ausstiegspläne Luftschlösser sind. Die Kernkraftwerke zu ersetzen, würde nicht nur zig Milliarden Schweizer Franken kosten, sondern auch Jahrzehnte dauern, und schon in naher Zukunft wäre die Energieversorgung des Landes nicht mehr gesichert. Dabei wird der Energiebedarf nach Angaben von Experten auch bei drastischen Maßnahmen zum Energiesparen ansteigen.
Eine der wichtigsten Stimmen gegen die irrationale grüne Position war Irene Aegerter, die „große alte Dame der Atomkraft“ in der Schweiz, die provokativ erklärte: „Ich bin eine Grüne.“ Schließlich sei Kernkraft für Klima- und Umweltschutz die beste Lösung. Einige Tage vor dem Referendum äußerte Aegerter zuversichtlich, früher oder später werde die Kerntechnik wiederkommen, wenn neue Generationen von Reaktoren entwickelt werden.
Bemerkenswert ist, daß die „Nein“-Stimmen gegen die grüne Initiative in den deutschsprachigen Kantonen deutlich höher waren als in den französischsprachigen. Das war ein Schlag ins Gesicht für die deutschen Grünen, die gehofft hatten, daß sich die deutschsprachigen Schweizer dem deutschen radikalen Anti-Atom-Kurs anschließen.
Die Schweizer Regierung hat zwar vor, längerfristig die Kernkraft durch andere Energiequellen zu ersetzen, verläßt sich aber anders als die deutsche Regierung dabei vor allem auf Wasserkraft, nicht auf Wind- und Solarenergie, die derzeit nur 4,3% des Stroms beitragen. Außerdem hat sie kein Datum für den endgültigen Ausstieg beschlossen, während Deutschland sich auf 2022 festgelegt hat.
Die in Zürich ansässige Stiftung Energy for Humanity, die sich für die friedliche Nutzung der Kernenergie einsetzt, kommentierte das Abstimmungsergebnis in einer Erklärung auf ihrer Internetseite, in der es heißt: „Wir freuen uns, daß das Schweizer Stimmvolk heute Nein zu einer frühzeitigen Abstellung und einem Verbot der Nutzung der Kernenergie gesagt hat... Die gesammelten Erfahrungen und Analysen der Energiewende in anderen Ländern sollen weiterhin eingebracht werden, damit in der Schweiz nicht die gleichen Fehlentwicklungen wie beispielsweise in Deutschland stattfinden... Mit dem heutigen Entscheid ist für Energy for Humanity noch klarer, daß eine künftige Energiestrategie auch fortgeschrittene Kerntechnologien eindenken sollte.“
eir/alh