|
|
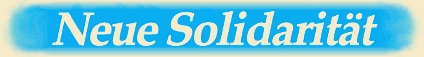
Südkorea setzt auf den technischen Fortschritt
Eine Zusammenstellung von Meldungen aus den letzten Jahren über Südkoreas wirtschaftliche Entwicklung zeigt, daß das Land - anders als die USA oder die Mitgliedstaaten der EU - auf wissenschaftlichen und technischen Fortschritt setzt:
Bis 2030 will Südkorea 80 Kernkraftwerke exportieren. Offenbar ist der Bau von vier Kernkraftwerken in den Vereinigten Arabischen Emiraten und weiteren in Verhandlung befindlichen Kernkraftprojekten in Jordanien, der Türkei, Rumänien und der Ukraine erst der Anfang der südkoreanischen Exportoffensive. Das Land will sich bis 2030 400 Mrd. $ an Aufträgen sichern. Damit wäre Südkorea der weltweit drittgrößte Exporteur von Kernkraftwerken. Vor allem zielt man auf Länder ab, die den Kernkraftsektor neu entwickeln - wie Indonesien, Vietnam, Malaysia, Thailand und Länder des Nahen Ostens.
Südkorea will die Zahl der Nuklearfachleute in zehn Jahren verdoppeln. Korea hat zwar für das gegenwärtige interne Programm und den Export von vier Kernreaktoren in die Vereinigten Arabischen Emirate genügend Experten. Wegen der geplanten Ausweitung ihres eigenen Kernkraftprogramms und der weiteren Exportmöglichkeiten werden wesentlich mehr Fachleute benötigt. Gebraucht werden Forschungs- und Entwicklungsexperten, Fachleute für die Bereiche Wartung, Bau-Baumanagement, Baudesign und Ausrüstung. Die südkoreanische Regierung will daher die Zahl der Kernreaktorexperten von 21.000 im Jahre 2008 auf 45.000 bis 2020 mehr als verdoppeln.
Südkorea baut eine neue Wissenschaftsstadt. In Sejong City (südlich der Hauptstadt Seoul) sollen in den nächsten zehn Jahren etwa 460.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Stadtplanung geht von einer halben Million Einwohner aus. Insgesamt sollen für das Projekt dieses nationalen Wissenschafts- und Bildungszentrums private und öffentliche Gelder von etwa 10 Mrd. Euro investiert werden.
Südkorea weiht einen Kernfusions-Versuchsreaktor ein. Schon 2007 nahm Südkoreas nationales Fusionsforschungsinstitut einen experimentellen Kernfusionsreaktor in Betrieb. Das Projekt KSTAR setzt supraleitende Materialien ein, die mit denen des Internationalen Thermonuklearen Versuchsreaktors ITER identisch sind und wurde mit südkoreanischer Technik gebaut. Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie will Südkorea bis 2021 eine der fünf führenden Mächte auf dem Gebiet der Fusionsenergie werden. Um das Jahr 2040 soll ein eigener kommerziell einsetzbarer Fusionsreaktor gebaut werden.
Hochgeschwindigkeitszüge verwandeln Südkorea „in eine große Stadt“.
Nach Plänen der südkoreanischen Regierung soll Koreas gegenwärtiges Schnellbahnsystem (KTX - Korean Train Express), das die Hauptstadt mit den beiden großen Städten im Süden, Pusan und Mokpo, verbindet, zu einem Streckennetz erweitert werden, das das Land vollständig vereint. „84 Prozent der koreanischen Öffentlichkeit werden in der Lage sein, Hochgeschwindigkeitszüge zu benutzen und sie werden 82 Prozent aller Stationen im Land in weniger als 90 Minuten und 95 Prozent in weniger als zwei Stunden erreichen“, berichtete stolz der Direktor für Transportfragen im Ministerium für Land-, Transport- und Hochseeangelegenheiten, Hong Soon-man. Somit werde das ganze Land praktisch „eine große Stadt“ werden. Die Ausweitung der Schienenstrecken soll etappenweise zwischen 2014 und 2020 realisiert, die Reisegeschwindigkeit dabei von anfänglich 250-300 km/h auf 400 km/h gesteigert werden.
Südkorea setzt Magnetbahntechnologie ein. Hyundai Rotem Co, ein südkoreanischer Zughersteller, stellte 2009 einen Magnetzug vor, der ab Herbst 2013 für den kommerziellen Betrieb eingesetzt werden soll. Nach dem Probebetrieb wird der Magnetzug eine 3,8 Meilen lange Strecke zwischen Incheon International Airport und einer U-Bahn-Station nahe Seoul befahren. Der unbemannte Zwei-Waggonzug wird 180 Passagiere aufnehmen und mit einer Spitzengeschwindigkeit von etwa 100 km/Stunde fahren.
Südkorea stellt historisches Wasserregulierungsprojekt fertig. Mit besonderen Feierlichkeiten beging Südkorea im Oktober 2011 an vier verschiedenen Orten die formelle Fertigstellung des Vier-Flüsse-Projektes. Staatspräsident Lee Myung-Bak war die treibende Kraft hinter diesem großangelegten Wasserregulierungsprojekt, das zusammen mit der Entwicklung der Kernenergie einen Hauptpfeiler seiner „Initiative für grünes Wachstum“ bildet. Die Fahrrinnen der vier größten Flüsse des Landes - Han, Nakdong, Geum und Yeongsan - wurden vertieft und ausgeweitet sowie 16 Stauwehre bzw. kleine Dämme gebaut, um Überschwemmungen zu verhindern, den Durchfluß zu regeln und die Flüsse insgesamt schiffbar zu machen. Die gewaltige Bautätigkeit brauchte zwei Jahre und kostete 17,7 Milliarden Dollar. „Es ist meine Hoffnung, daß die Erschließung der vier Flüsse zu regionalem Wachstum führt und daß [das Projekt] die Herzen der Menschen berührt“, sagte Lee bei der Einweihungsfeier an der Staustufe Ipo am Han-Fluß.